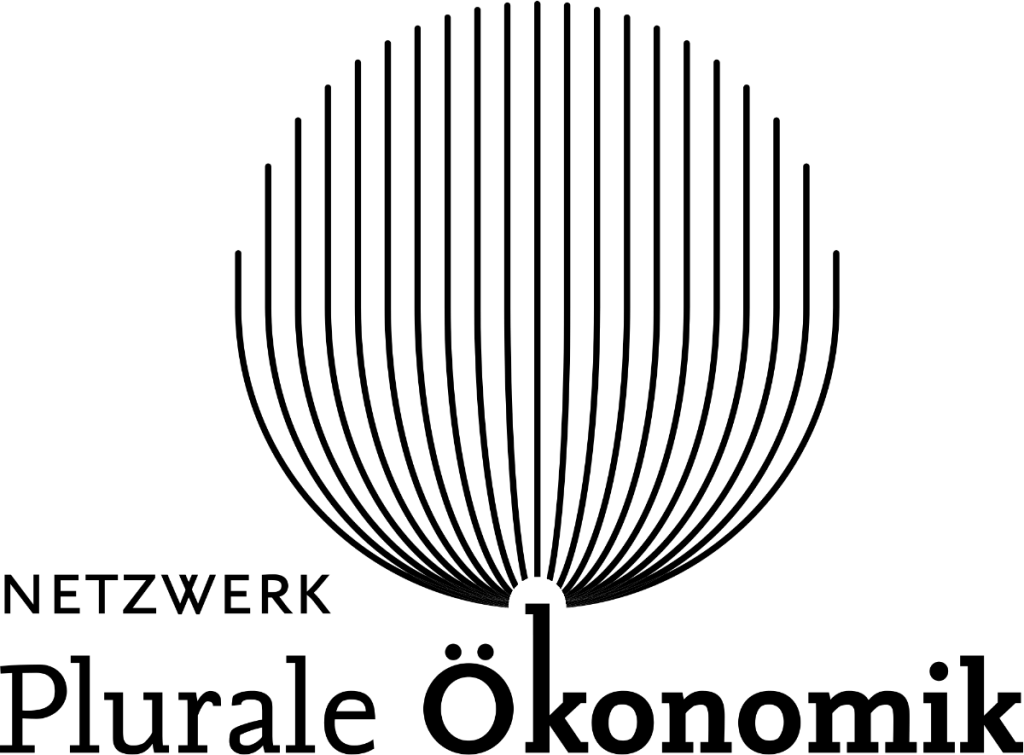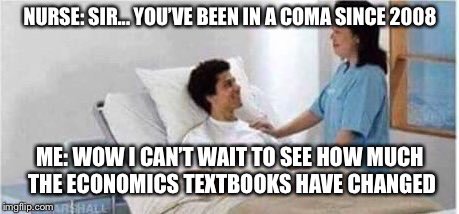Das Ansinnen, an den Wirtschaftsfakultäten möge mehr plurale Ökonomie gelehrt werden, ist berechtigt. Aber was dann gewünscht wird, ist viel zu bescheiden. Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Birger Priddat
Das Ansinnen, an den Wirtschaftsfakultäten möge mehr plurale Ökonomie gelehrt werden, ist berechtigt. Aber was dann gewünscht wird (vgl. den Samstagsessay der SZ vom 22/23.11. ‚Welcher Irrtum, bitte?’), ist viel zu bescheiden. Dass man nicht nur neoklassische Rechenkunst lernen möchte, ist verständlich. Dass die ‚Neoklassik’ inzwischen ein breites Gebiet geworden ist, das viele Ansätze enthält, darf allerdings auch nicht übersehen werden. Es bietet intelligente Konzeptionen, die etliche logische Möglichkeiten durchspielen. Oft allerdings unter problematischen Annahmen. Aber zur Einführung in die grosse Wissenschaft der Ökonomie bedarf es kluger Vorlesungen und Seminare, die die Breite des Faches synchron und diachron zeigen. D.h. auch in geschichtlicher Entwicklung. Denn die Theorien sind jeweils Kinder ihrer Zeit und in der Breite des Faches läßt sich zeigen, dass es keinen selbstverständlichen Kodex hat, keine Dogmata, keinen ‚natürlichen’ Kern.
Aus der Theoriegeschichte lässt sich am ehesten erweisen, was an verschiedenen Konzepten und Denkstilen möglich ist. Um dann in das Spektrum der Theorien zu gehen. Was nützt es, die ‚Wahrheit’ des Gleichgewichtes und der Modellkonstruktionen des rational actors monopolartig zu lehren, wenn dadurch der Wettbewerb der Theorien verhindert wird? Wo bleibt dann die Möglichkeit der rationalen Wahl für die Studierenden? Dass die Verfechter einer Mainstream-Grammatik des Ökonomischen die anderen Ansätze nicht tolerieren, kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber den Studenten die anderen Ansätze vorzuenthalten, ist nicht nur unfair. Sondern vor allem nicht von den abstinenten Kollegen zu entscheiden. Wer als Gleichgewichtstheoretiker z.B. nichts von den evolutionary economics hält, ist deswegen nicht qualifiziert, sie auszuschliessen. Er kennt sie meist gar nicht.
Natürlich ist es, gerade zu Beginn des Studiums, angemessen, einen bereiteren Theorieüberblick zu bekommen. Das Menü sollte aufgeblättert werden. Wie sonst soll man sich ein Urteil über die Wirtschaft bilden – denn es sind die Theorien, die jeweils verschiedene Perspektiven auf die Wirtschaft bieten. Da die meisten Studenten nicht in die Wissenschaft gehen werden, ist ihre Anreicherung mit abstrakten mathematischen Modellen, die sie in praxi nie brauchen, geradezu gegen die Prinzipien der Bolognareform gerichtet, die die Berufsfähigkeit wenigstens in den Bachelorstudiengängen fordert. Mit marxistischer Ökonomie, die die Fragen des Verhältnisses von Macht und Ökonomie forciert, mit evolutionärer Ökonomie, die die Prozeßhaftigkeit der Marktenwicklungen analysiert etc. sind sie oft besser bedient für das Verstehen tatsächlicher Wirtschaftsprozesse. Mich irritiert nur, dass man – als plurale Alternative – wieder nur kodifizierte und z.T. schematisiert Theorien fordert. Marxismus, Evolutionsökonomik, Hayek’sche Marktprozeßtheorie, ‚Keynesiansimus’ sind selber bereits großteils theorie-geschichtliche Bestände. Ich schlage hingegen vor, in avanciertere Entwicklungen der Ökonomie vorzustossen, d.h. sich auf elaborierte andere und neue Konzepte einzulassen. Hier spielt die transdiziplinäre Musik.
Denn was nützt es, plurale Ökonomik an Fachbereichen zu fordern, die gar keine Forscher haben, die sich in den alternativen Theorien auskennen? Stellen und Budgets sind knapp, und Fakultäten, die sich für den Mainstream entschieden haben, werden dafür keine Ressourcen freistellen. Da bleibt dann nur die alternative studentische Arbeitsgruppe: aber was liest die anderes als ältere kodifizierte alternative Texte? Well done, immerhin. Aber in die neusten Forschungen, die uns bewegen werden, gelangt man so nicht. Es geht gar nicht um Opposition zum Mainstream, sondern um die Suche und Kooperation an neuen erfolgversprechenden avancierten Forschungen: um experimentelles Studieren.
Ich gebe ein paar Beispiel, Anregungen. Z.B. die Forschungen von Carsten Herrman-Pillath, der – aus der evolutionary economy kommend – einen eigenen Ansatz einer naturalistischen Ontologie als Fundament der Ökonomie entwickelt (Foundations of Economic Evolution: A Treatise on the Natural Philosophy of Economics 2013; Economics of Identity and Creativity 2011; (zus. mit I.A.Boldyrev) Hegel, Institutions and Economics: Performing the Social 2014). Herrmann-Pillath verbindet neuroscience (und neuriolinguistics) mit neuen prozeßtheoretischen Konzepten – ein naturalistic turn innerhalb der Ökonomik, der international bereits Resonnanz findet.
Aus der Spieltheorie herkommend sind Herbert Gintis (The Bounds of Reason. Game Theory and the Unification of the Behaviorial Sciences 2009) und Alain Kirman (Complex Economics: Individual and Collective Rationality 2011) anregende Forscher; Gintis mit seiner Einarbeitung der Verhaltensökonomik und Kirman mit der ökonomischen Aufbereitung wirtschaftssoziologischer Erkenntnisse.
Die Wirtschaftssoziologie ist inzwischen selber eine aufregende Welt der Überprüfung und Neukonstitution ökonomischer Interaktionen, z.B. Jens Beckert (Beckert / Musselin (eds.): Constructing Quality: The Classification of Goods in Markets 2013; Beckert (ed.): The Worth Of Goods: Valuation and Pricing in the Economy 2010; vgl. auch Beckert: Capitalist Dynamics. Fictional Expectations and the Openness of the Future. MPIfG Discussion Paper 14/7. Köln 2014 (demnächst als Buch)). Die Soziologen betonen die Interaktionsformen, die wechselseitigen Beobachtungen der Akteure, mit daraus entstehenden anderen Marktinterpretationen.
Wolfgang Streeck hingegen forscht zur politischen Ökonomie – einer in Deutschland untergegangen Wissenschaftsabteilung – über die Verhältnisse von Macht, Politik, Ökonomie und Institutionen (Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus 2013). In der neuen Institutionenökonomik finden wir solche Ansätze – wenn auch anders konfiguriert und begründet – exzellent bei Daron Acemoglu (mit J.A. Robinson: Warum Nationen scheitern: Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut 2014).
Der Kulturwissenschaftler Josef Vogl hingegen bietet grosse geschichtliche Interpretationen der Ökonomieentwicklung (Das Gespenst des Kapitals 2010; Kalkül und Leidenschaft: Poetik des ökonomischen Menschen 2008), die bei den Ökonomen selten geworden sind: Ausnahme Deidre McCloskey (The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce, 2006; Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World 2010).
Aber auch Ökonomen gehen in das Gebiet der Kultur, so der St.Gallener Ökonom Ernst Mohr (Ökonomie mit Geschmack. Die postmoderne Macht des Konsums 2014), der eine neue Konsumtheorie vorstellt, die die intellektuellen Ressourcen der Kulturwissenschaften nutzt und damit die Formation der Ökonomik selber ändern muß.
Wer sich hingegen in die komplexen Prozesse der Ungewißheitsabsorption der Ökonomie gegeben will, findet bei Didier Sornette kompetente Konzeptionen (Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems 2003). Und wer sich an der Relation Natur und Ökonomie abarbeiten will, bei Robert U. Ayres und B. Warr ( The Economic Growth Engine: How Energy and Work Drive Material Prosperity 2010) eine wachstumstheoretische Analyse, die das Verhältnis von Kapital, Arbeit und Energie neu konstituiert.
Die digital economy wird uns in den nächsten Epochen neue Konzepte bescheren; über erste Einsichten lessen wir bei Alexander Pentland aus dem MIT digital Lab (Social Physics 2014). Fernab von konventionellen ökonomischen Methoden werden hier social patterns analysiert, die die Ökonomie re-modellieren könnten: Märkte werden dann nurmehr über bilaterale Transaktionen konfiguriert, mit individuellen pricing, im Netzwerkontext.
Es ist eine willkürlich zusammengestellte Liste von Anregungen, sich mit avancierter Forschung auseinanderzusetzen – in sich heterogen, aber es kommt ja darauf an, die Themen zu finden, die einem einen eigenen Ansatzpunkt bieten, um selbständig einzusteigen. Dabei hilft es darüberhinaus womöglich, sich mit wirtschaftsphilosophischen Fragen auseinanderzusetzen, weil dort schärfer und freier nach den Voraussetzungen gefragt wird, die die Ökonomie verwendet (W.D. Enkelmann; B.P. Priddat (Hrsg.): Was ist? Wirtschaftsphilosophische Erkundungen; Bd.1 2014; die Bände 2 + 3 folgen 2015). Hochkomplex, in Verbindung von Derivatenökonomie, Erkenntnistheorie und Literatur: Elie Ayache (The blank swan. The End of probability 2010). But that’s really hard stuff. Neu zu denken ist anstregend.
Eine angemessenere Strategie lautet also, sich die Forscher zu suchen, die alternative Theorien erarbeiten. Sie sind einzeln verstreut über die Universitäten, aber erreichbar. Natürlich lassen sie sich überreden, geeignete Formate zu erfinden, in denen man mit ihnen zusammen die Alternativen erarbeiten kann. Das Format der Summer-School böte sich. Und man kann das – dank des Bologna-Systems – auch mit Credit-Punkten verbinden. So liesse sich eine virtuelle Universität aufbauen, in der sich neugierige und aktive Studenten das Studium pluraler Ökonomie besorgen, das sie an ihren Fakultäten nicht vorfinden bzw. auch nicht erwarten können. Die virtuelle Universität kann man alleine organisieren oder en collectiv. Wenn man von einer alternativen Theorie bzw. von einem ihrer Erforscher angetan ist, kann man auch die Universität wechseln. Da ist umständlich, aber wer hier eine wahre Alternative sieht, wird die Energien aufbringen. Niemand hat versprochen, dass Studieren bequem sein soll.
Was zwingt einen, ausschliesslich das Programm der Universität bzw. Fakultät abzuarbeiten, an die man mehr oder minder zufällig geraten ist? Universitäten sind keine Schulen, sondern ein diversifizierter Wissens- und vor allem Forschungsraum, in dem sich neugierige und anspruchsvolle Studenten die Orte, Personen und Theorien suchen, die sie attrahieren. Für Ökonomen dürfte das zu denken selbstverständlich sein. Oder? Mobilisez-vous!