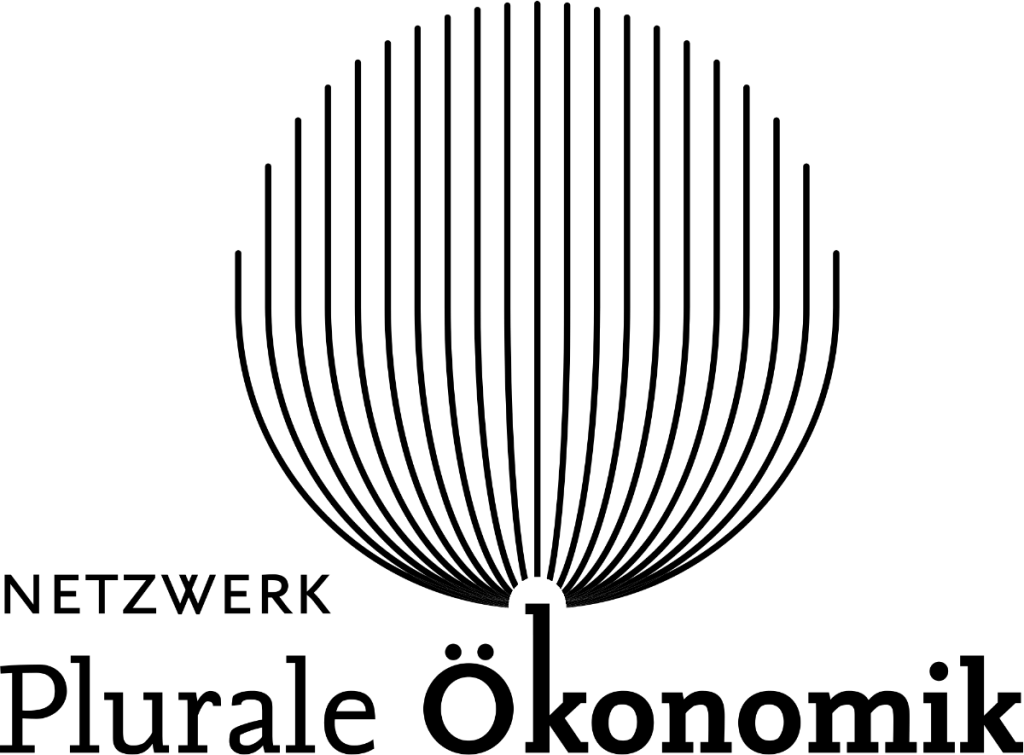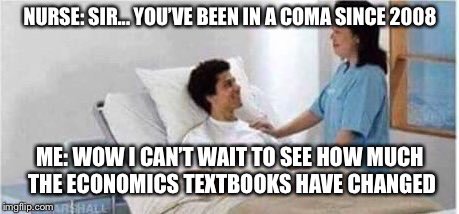Warum die realwirtschaftliche Sicht von Nikolai Kondratieff die aktuelle Situation besser erklärt als monetäre Theorien
Ein Gastbeitrag von Erik Händeler
Die meisten Schulen der Volkswirtschaft erzählen von Preisen, Zinsen und Geldmenge. Doch die monetären Symptome sind eher die Folge, nicht Ursache für wirtschaftliche Entwicklung, meinte der Ökonom Nikolai Kondratieff (1892 – 1938): Diese sei im realen Leben zu suchen, in den Veränderungen von Produktionsfaktoren und deren Organisationsmuster. Seine realwirtschaftliche Betrachtungsweise ist angesichts der aktuell instabilen Konjunktur eine Chance, die Grundannahmen der Wirtschaftswissenschaft neu zu diskutieren.
Finanz- und Wirtschaftskrisen werden nicht von finsteren Mächten auf den Finanzmärkten verursacht. Sie sind ganz normale Erscheinungen einer freien Marktwirtschaft, deren Strukturen sich in einem ungleichmäßigen Tempo wandeln: Nachdem der Computer uns all die strukturierten Wissensarbeiten weitgehend abgenommen hat, die er uns abnehmen konnte, fehlen jetzt die großen Kosten senkenden Produktivitätsfortschritte. Gewinne werden herunterkonkurriert, Schulden können nicht mehr so leicht bedient werden, die unproduktiveren Volkswirtschaften geraten als erste unter den Druck von Arbeitslosigkeit. Es fehlt an rentablen Investitionsmöglichkeiten, deswegen sind die Zinsen fast bei null, das freie Geld fließt in die Spekulation und treibt die Preise von Aktien und Immobilien. Deflation zieht trotz gestiegener Geldmenge auf, weil die Geldumlaufgeschwindigkeit sinkt. Es wird ungemütlich – bis es uns gelingt, im Management, in der Schule und im Verhalten die nächsten Wohlstandsmuster umzusetzen.
Das alles sind die üblichen Symptome eines zu Ende gegangenen Strukturzyklus, wenn sich ein technologisches Netz weitgehend ausgebreitet hat, aber die Infrastruktur und Kompetenzen des nächsten technologischen Netzes noch nicht ausreichend erschlossen sind: Das war so in den Jahren nach dem Gründerkrach 1873, nachdem die Eisenbahnen zwischen den damaligen Gewerbezentren weitgehend gebaut waren; oder 1929ff, nachdem die Wirtschaft durchelektrifiziert war; und nach dem Autoboom bis in die 1970er-Jahre. Zwar wurden später nach der Ölkrise 1973 noch mehr und immer bessere Autos gebaut. Aber die treibende, produktivitätssteigernde Kraft war jetzt der Computer, mit dessen Hilfe man Autos billiger und besser bauen konnte.
Das Erklärungsmodell
Solche langen Strukturzyklen hatte der Ökonom Nikolai Kondratieff (1892 – 1938) im Jahr 1926 beschrieben.1 Im Kohleverbrauch, in Preisen und in der Industrieproduktion westlicher Länder hatte er seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert zweieinhalb 47 bis 60 Jahre lange Wellen wirtschaftlicher Dynamik gefunden, und die dritte Welle zeigte nun nach unten. Damit sagte er schon lange vor dem Börsencrash die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre vorher. Dass diese gar nicht der Zusammenbruch des Kapitalismus sei, wie es Karl Marx immer schon prophezeit hatte, sondern lediglich ein tiefes Konjunkturtal zwischen zwei techno-sozialen Zyklen – diese Aussage führte ihn in Stalins Reich in Einzelhaft. 1938 wurde er exekutiert –Wirtschaftswissenschaft kann durchaus lebensgefährlich sein.
Kondratieff liefert eine Erklärung für die tiefen Krisen, denen monetär ausgerichtete Ökonomen ratlos gegenüberstehen: Zu jeder Zeit arbeiten Unternehmen mit einem bestimmten Mix an Produktionsfaktoren. Diese wachsen jedoch nicht im selben Maße mit wie die gesamte Volkswirtschaft und verändern so untereinander ihre relativen Kostenverhältnisse. Irgendwann lässt sich ein bestimmter Produktionsfaktor nicht weiter physisch vermehren; er wird zu teuer. So lohnt es sich für Unternehmer nicht, die Herstellung auszuweiten – die Wirtschaft stagniert, die Margen sinken gegen Null, Leute werden entlassen. Kondratieff nennt den knappsten Produktionsfaktor die „Realkostengrenze“, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um ein Problem handelt, dass sich mit Geld lösen ließe, sondern um ein physisches Problem: Wenn schon alle Programmierer programmieren, kann man ihnen noch so viel Geld zahlen, ihre Leistungsfähigkeit lässt sich dadurch nicht steigern. An diesem Flaschenhals der Produktion entsteht nun der große Veränderungsdruck, der Wirtschaft und Gesellschaft zwingt, sich etwas Neues einfallen zu lassen.
Als die englischen Unternehmer nicht mehr hinterherkamen, ihre Bergwerke zu entwässern und Blasebälge für die Eisenschmelze zu betätigen, beauftragten sie den wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Edinburgh, eine Dampfmaschine zu entwickeln – James Watt tüftelte zwölf Jahre lang, bis diese endlich ausreichend effizient war – erst das sprengte die Realkostengrenze. Und die Eisenbahn wurde nicht deshalb gebaut, weil die Leute keine Lust mehr hatten, mit der Kutsche zu fahren, sondern weil die fehlenden Transportmöglichkeiten die damals größte Bremse für das Wirtschaften war – die Unternehmer mussten sie gegen den anfänglichen Widerstand der Gesellschaft durchsetzen.
Nachweis von lange Zyklen: Kondratieff machte sie an dem Aufstieg eines „Fonds zusammenhängender Kaptalgüter“ im realen Leben fest, was Schumpeter später mit dem Begriff „Basisinnovation“ versah. Diese breitet sich zunächst langsam, dann stark ansteigend aus, bis das Wachstum sich abbremst und die maximale Ausbreitung erreicht ist. Dieser S-förmige Verlauf lässt sich – bezogen auf eine Region – mathematisch gut beschreiben. Wenn man die Wachstumsraten darstellt (erste Ableitung der S-Kurve), erhält man eine Glockenkurve. Wenn man daraus die Veränderungsrate des Wachstums (2. Ableitung) extrahiert, erhält man eine Sinuskurve. Sie verdeutlicht die populäre Darstellung von Kondratieffkurven: Natürlich gibt es keine Sinuskurve, die durch die Weltgeschichte schwingt – es gibt keine Zeitzyklen von 50 Jahren. Denn ihre Länge hängt davon ab, ob sich eine Gesellschaft zum Beispiel gegen die Eisenbahn wehrt oder sie schnell baut. Die Zyklen verlaufen weltweit auch nicht genau parallel, der Höhepunkt des Eisenbahnkondratieffs war in den USA 1866 nach dem US-Bürgerkrieg, in Mitteleuropa 1873 – so wie wir den Gipfel des IT-Kondratieffs schon in den Nullerjahren erreichten, und dann noch vom Verkauf von Maschinen und Autos in die Schwellenländer lebten, was nun zu Ende geht. Spätere Wissenschaftler scheiterten bei dem Versuch, Kondratieffzyklen mit langen Zeitreihen von Bruttosozialprodukt oder anderen monetären Indikatoren nachzuweisen. Denn weder strukturelle Veränderungen – die Baubranche setzt in einem Jahr 30 Milliarden Euro weniger um, die Gesundheitsbranche dagegen um diesen Betrag mehr – schlagen sich im Bruttosozialprodukt nieder, noch qualitative Veränderungen: Ein PC kostet heute nur halb so viel wie vor einigen Jahren, hat aber eine zigfach höhere Leistungsfähigkeit. Kondratieffzyklen, also die wirtschaftliche Dynamik, sind zu identifizieren an der Veränderungsrate des Wachstums, in der der Gesellschaft neue Ressourcen hinzuwachsen, die sie für mehr von demselben oder für völlig Neues zusätzlich verwenden kann.
Es geht um das Maß der Einsparungen von Zeit und Rohstoffen: Nicht das Geld für den Bau von Eisenbahnen oder für Fahrkarten trieb den Eisenbahn-Kondratieff an. Sondern weil man so viel Zeit sparte, in der man etwas anderes, Zusätzliches arbeiten konnte – das war das Wachstum. Nicht das Geld für Gesprächsgebühren von Handys treibt die Wirtschaft. Sondern weil man im Zug sitzend plötzlich am Smartphone arbeiten oder sich effizienter abstimmen kann, das steigert die Produktivität und lässt einen die Zeit besser nutzen; die realen Effizienzgewinne erzeugen das Wachstum. Nicht die Honorare für Mediatoren vermehren den Wohlstand, sondern wenn zwei Abteilungsleiter wieder miteinander reden und Informationen fließen, so dass man doch noch zu der großartigen Lösung kommt – das erhöht die Leistungsfähigkeit. Und Gesundheit wird nicht Wachstumsmotor, weil wir wegen der vielen Alten noch mehr Geld für Medikamente und Stützstrümpfe ausgeben. Sondern wenn wir den Stress aus dem Arbeitsleben nehmen, und bei weniger Arbeitslast flexibler viel länger arbeiten, dann ist die zusätzlich erbrachte Leistung, die längere produktive Lebensarbeitszeit, die besser Amortisierung des Bildungskapitals, das ist der zusätzliche Wohlstand.
Lange Wellen sind aber nicht nur ein ökonomischer, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Reorganisation: Die Wirklichkeit ist etwas Ganzes. Jeder dieser Zyklen hat seine eigenen Wohlstandsmuster, um die neue Realkostengrenze zu überwinden und das nächste technologischen Netz optimal zu nutzen: Managementmethoden, Firmenstrukturen, Bildungsanforderungen. Wer wie England um 1800 das neue Netz rund um Dampfmaschine und dann um Eisenbahn nutzt, ist am produktivsten und steigt auf; wer wie England dann aber an den alten Erfolgsmustern festhält, wird vom Deutschen Reich rasant überholt, das in die neue Basisinnovation rund um den elektrischen Strom investiert. Die Sowjetunion konnte Weltmacht sein, als es um billige Erdölenergie ging, musste aber zusammenbrechen, als sie mit ihren starren Strukturen die neue Realkostengrenze der Informationsflut nicht überwinden konnte, wie es der Computer tat. Japan stieg auf, weil es Computer anwendete und weiterentwickelte, aber stagniert nun, weil die neuen Knappheiten im immateriellen Bereich der Wissensarbeit liegen, die sich nicht mit Technology erschließen lassen.
Geschichte verstehen
Im langen Aufschwung herrscht immer eine optimistische, liberale Stimmung vor, etwa im Jugendstil (Elektro) oder während der Beatles-Zeit (Auto); im langen Abschwung dagegen ist die Haltung ängstlich, struktur-konservativ wie im Biedermeier (nach Dampfmaschine) und im Historismus (nach Eisenbahnboom). Im Aufschwung werden Kriege ausgetragen, weil sich das Machtgleichgewicht verschiebt und man meint, sich Kriege leisten zu können, im langen Abschwung werden Konflikte nicht militärisch ausgetragen. Gewerkschaften setzen sich im langen Aufschwung durch, im Abschwung werden Arbeitnehmerrechte gegen Null gefahren. Die Kondratiefftheorie hilft, die Fächer Wirtschaft und Geschichte wieder zu vereinen, so wie früher, bevor sie nach dem Sieg der auf die monetär-mathematischen Schmalspur reduzierten Vertreter getrennt wurden. Anstatt wie die Neoklassik die Wirklichkeit immer weiter aufzusplitten, liefert Kondratieff eine Gesamtsicht aller Bestandteile.
Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik: Der Widerstand in den Fakultäten, sich näher mit Kondratieff auseinanderzusetzen, liegt darin begründet, dass die realwirtschaftliche Sichtweise vielen bisherigen Dogmen in Frage stellt. Dabei werden die Lehren der Klassiker, Keynesianern und Monetaristen durch Kondratieff nicht ungültig, sie werden nur in Beziehung gesetzt zur Phase des Produktivitätswachstums. Ob steigende Geldmenge die Wirtschaft antreibt, zu Inflation führt oder wirkungslos verpufft, hängt allein davon ab, ob das Produktivitätswachstum gesamtgesellschaftlich gerade zunimmt oder sinkt. Es nützt also nichts, wenn die Bergwerke in den 1920er Jahren durch Elektro-Bohrhammer viel produktiver werden und Bergleute freisetzen, die aber von sonst keiner Branche gerade aufgenommen werden können – was zählt, ist die Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft. Steigende Zinsen sind völlig egal, wenn sie sich im realen Leben auch bezahlen lassen, weil eine Dampfmaschine gerade das Maß an zusätzlichen Ressourcen weit darüber hinaus erhöht; während Nullzinsen völlig wirkungslos bleiben, wenn es im realen Leben aktuell nichts mehr gibt, wofür es sich lohnt, zu investieren.
Ob höhere oder niedrigere Steuern für ein Land besser sind, das unter Transportknappheit leidet, lässt sich nicht generell sagen: Der Staat könnte mit den höheren Einnahmen die Eisenbahn bauen, aber auch die Privatleute, die mehr Geld in der Tasche haben – das einzige, was zählt, ist, dass der Transportaufwand reduziert wird. Es ist egal, woher das Geld kommt. Wahrscheinlich ist es aber so, dass bei niedrigeren Steuern die Reichen ihr Geld nicht in die Eisenbahn stecken, sondern sich eine Yacht oder ein unproduktives Urlaubshäuschen in Südfrankreich kaufen, was nicht die realwirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes steigert. Ein Land mit höheren Steuersätzen wird daher insgesamt erfolgreicher sein als ein Land, das nicht in die Leistungsfähigkeit seiner Infrastruktur und seines unteren Bevölkerungsdrittels investieren kann.
Keynesianische Ausgabenprogramme verpuffen, weil sie blind sind für die Wirklichkeit: Als die westdeutsche Regierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt auf die Ölkrise mit großen Staatsausgabenprogrammen reagierte, führte das lediglich zu Inflation in sowieso überhitzten Branchen, während andere Branchen Mitarbeiter entließen und die Bundesbürger einfach mehr sparten – die monetären Maßnahmen stießen ins Leere, weil die Realwirtschaft stagnierte und sie nicht an der neuen Knappheit Informationsverarbeitung ansetzte. Als Helmut Kohl 1982 an die Regierung kam, kürzte er Staatsausgaben und Sozialleistungen und erhöhte die Sozialbeiträge sowie Verbrauchssteuern. Nach herrschender Lehre hätte es keinen schnelleren Weg in die Rezession geben können. Stattdessen sprang die Konjunktur an – weil der Computer gerade im realen Leben Ressourcen einsparte, Gewinne erhöhte und so neue Investitionen und Arbeitsplätze wieder rentabel machte. Keynesianische Politik der Nachfragesteuerung sollte also die Gießkanne zurück ins Häuschen stellen und zusätzliche Nachfrage erzeugen durch die Investitionen an der Realkostengrenze. Das sollte mal jemanden den Japanern sagen, die mit Staatsschulden gerade ihr Land zubetonieren, anstatt die immaterielle Leistungsfähigkeit ihrer Bewohner zu fördern.
Zum ersten Mal stehen wir vor einer immateriellen Knappheitsgrenze in einer zunehmend immateriellen Wirtschaft: Dass Informationsarbeit nicht ausreichend effizient ist, dafür sprechen viele Indikatoren wie innere Kündigung oder Kommunikationsprobleme – die Berufstätigen geraten vor allem mit ihrem Sozialverhalten unter den Veränderungsdruck, effizienter zusammenzuarbeiten, um Wissen besser zu nutzen. Und weil Bildung zu einer teuren, Jahrzehnte langen Investition wird, muss sie sich auch länger amortisieren. Würden Politik und Universitäten Kondratieffs Globalsicht entdecken, sie würden sich jetzt im realen Leben um eine bessere Arbeitskultur und um Gesunderhaltung auch der Gesunden kümmern. Damit hätte dann Kondratieffs Theorie 77 Jahre nach seinem Tod noch etwas bewiesen: Dass Ideen langfristig doch stärker sind als Bajonette und Ignoranz.
____________________________
Kondratieff, N.D: Die langen Wellen der Konjunktur. In: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 56 (1926), S. 573. Als Faksimile-Reprint neu herausgegeben und kommentiert von Erik Händeler: Kondratieff/Händeler, Die langen Wellen der Konjunktur, Marlon Verlag, Moers 2013.
____________________________
Erik Händeler ist als Buchautor und Zukunftsforscher vor allem Spezialist für die Kondratiefftheorie der langen Strukturzyklen. Nach Tätigkeit als Stadtredakteur in Ingolstadt studierte er in München Volkswirtschaft und Wirtschaftspolitik. 1997 wurde er freier Wirtschaftsjournalist, um die Konsequenzen der Kondratiefftheorie in die öffentliche Debatte zu bekommen. 2010 zeichnete ihn die russische Akademie der Wissenschaften mit der Bronze-Medaille für seine wirtschaftswissenschaftliches Arbeiten über den Zusammenhang zwischen monetärer und realwirtschaftlicher Welt aus.