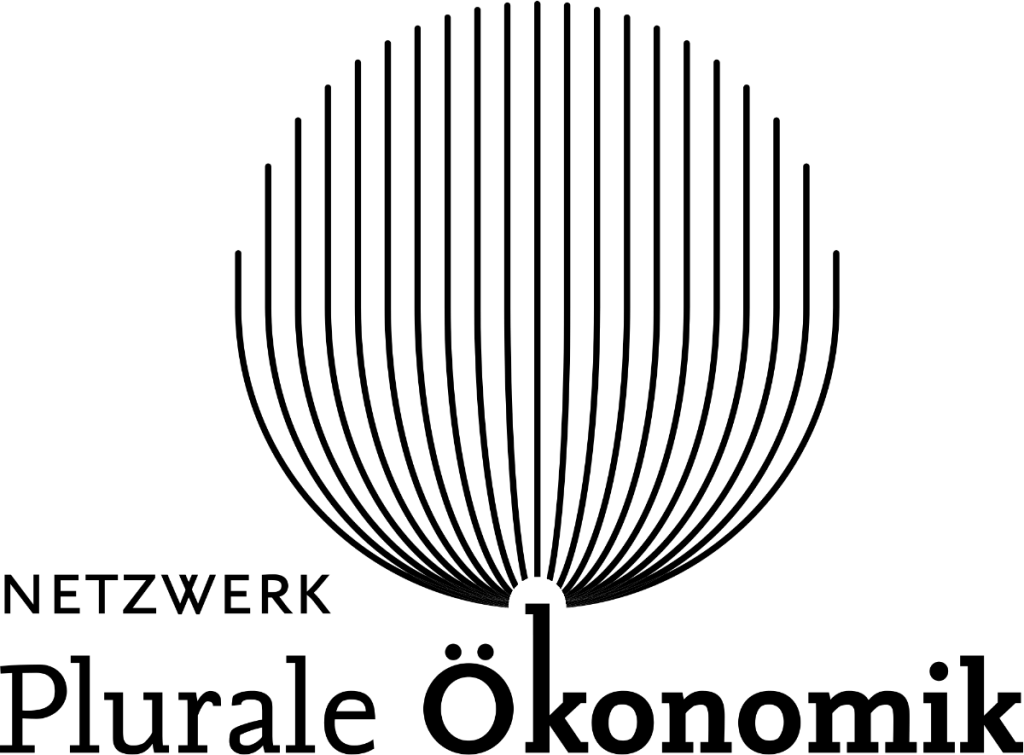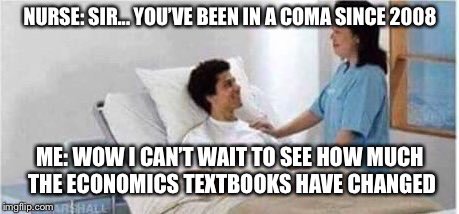Mit Beginn der Pandemie hat sich über unsere internationale Dachorganisation Rethinking Economics eine Gruppe von Studierenden aus der ganzen Welt zusammengefunden, um ein Update des ISIPE Open Letter von 2014 zu schreiben. Dieser ist auch als Reaktion auf die Finanzkrise und der unzureichenden Adaption der Lehre auf die Krise verfasst. Seit der Veröffentlichung dieses Briefes sind bereits 8 Jahre vergangen und einige Dinge haben sich in der Ökonomik verändert, viele aber auch nicht. Die Pandemie stellt eine nächste ökonomische Krise dar, mit deren Umgang sich die ökonomische Lehre endlich beschäftigen sollte.
Dieser Aufruf wird gleichzeitig auch auf Englisch, Spanisch und Französisch von Rethinking Economics International veröffentlicht.
Wir leben in einem Zeitalter der multiplen Krisen: die Krise im Gesundheitswesen, der globale Klimanotstand und die Ungleichheit der Klassen, Geschlechter und Ethnien, um nur einige der wichtigsten zu nennen. Das Auftreten der globalen Covid-19-Pandemie, die wachsende Präsenz von Bewegungen gegen Rassismus auf der ganzen Welt, die Zunahme von Naturkatastrophen aufgrund des Klimakollapses: Dies sind nicht nur Entwicklungen, die zurzeit die Schlagzeilen und das Handeln der Regierungen dominieren. Es sind tiefgreifende und allgegenwärtige Probleme, deren Verschwinden sich nicht andeutet.
Als engagierte Studierende sind wir der Meinung, dass das Credo „business as usual“ nicht mehr gelten kann. Jedoch sehen wir, dass das Tempo des Wandels in der ökonomischen Lehre und in der Disziplin selbst nicht mit den aktuellen Ereignissen Schritt hält. Gleichzeitig sind wir besorgt darüber, dass in der Disziplin kaum Versuche unternommen werden, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen und diese zu reflektieren. Dieser Call for Change erhebt nicht den Anspruch, alle Antworten auf unsere Fragen zu geben. Er ist ein Aufruf zum Handeln und ein Wirtschaftsstudium aufzubauen, das sich selbst reflektiert, die Neugier an Ökonomie stimuliert und vielfältige, plurale Inhalte vertritt.
Die vergangenen zwei Jahre haben die Grenzen des ökonomischen Instrumentariums verdeutlicht, das uns Studierenden zur Verfügung steht. Wir fragen uns, ob Wirtschaftsstudierende in der Lage sind zu verstehen, wie Regierungen auf der ganzen Welt auf die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise reagiert haben. Die Bewältigung der zahlreichen sich überschneidenden Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, erfordert proaktive und kreative Lösungen durch ein besseres Verständnis der wissenschaftlichen Grundlagen unserer Disziplin. Es braucht vielfältige Methoden und wirtschaftliche Perspektiven, damit die Wirtschaftswissenschaftler:innen des 21. Jahrhunderts auf die komplexen gesellschaftlichen Probleme reagieren können, mit denen wir konfrontiert sind. Die Suche nach Lösungen muss mit einem pluralen Studium beginnen. Dabei liegt unser Augenmerk auf zwei Bereichen: auf der ökonomischen Bildung und den Ökonom:innen selbst.
Ökonomische Bildung
Bis heute wird weltweit an den meisten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten gelehrt, dass alle Menschen wirtschaftliche Entscheidungen weitestgehend auf die gleiche Weise treffen. Dabei wird unsere komplexe und ineinander verwobene Welt kaum berücksichtigt. Kontext ist allerdings wichtig, denn die wirtschaftliche Realität ist nicht für jede:n gleich. Man kann nicht dieselben ökonomischen Herangehensweisen anwenden und davon ausgehen, dass sie immer noch funktionieren, wenn sich die Umstände komplett ändern. Dieser fehlerhafte Ansatz führt zu politischen Maßnahmen, die die Lebenswirklichkeiten der Betroffenen nicht widerspiegeln. Die Wirtschaftswissenschaften sollten ihre Theorien an die reale Welt anpassen und nicht umgekehrt erwarten, dass ihre Theorien die reale Welt formen.
Wir sind besorgt, dass die Ökonom:innen von morgen, weder in Theorie noch in Praxis, mit den „richtigen Werkzeugen“ ausgestattet werden, um mit großen Krisen und Ungewissheiten umzugehen. Wir sorgen uns, dass sie die realen Probleme nicht bearbeiten können, da diese in den Lehrplänen der Wirtschaftswissenschaften nur wenig Beachtung finden.
Wirtschaft wird nicht im luftleeren Raum gelehrt. Die ökonomische Lehre prägt nicht nur, wie die Menschen die Welt verstehen, sondern auch ihre Fähigkeit, diese Welt maßgeblich zu beeinflussen. Dennoch wird Vertreter:innen unseres Fachs oft mangelnde Bescheidenheit und eine Abneigung gegen die Zusammenarbeit mit anderen Sozial- oder Naturwissenschaften vorgeworfen. Die Folgen eines unzureichenden interdisziplinären Studiums führen dazu, dass interdependente Ereignisse nur mit einem Tunnelblick betrachtet werden. Es ist daher unerlässlich, andere Sozial- und Naturwissenschaften wieder ins Wirtschaftsstudium und in den ökonomischen Diskurs zu integrieren, so wie es früher der Fall war.
Akteur:innen der Ökonomie
Die Spielregeln dafür, was Wirtschaftswissenschaften sind und sein sollten, legen nach wie vor mächtige Akteur:innen in einer globalen Hierarchie fest: die „Top-Universitäten“, „Top-Zeitschriften“ und „Top-Konferenzen“. Wir behaupten nicht, dass dieses Gruppendenken aus bösen Absichten entsteht, aber in der Wirklichkeit sind diese Institutionen oft keine offenen Räume für neue Ideen, und ihr Denken vernachlässigt die Lebensrealitäten von marginalisierten Gruppen. Deren Perspektiven sind allerdings besonders wichtig, da wirtschaftspolitische Entscheidungen tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben ALLER Menschen haben. Die Aufgabe der Ökonom:innen sollte es sein, den Inhalt gesellschaftlicher Debatten in eine verständliche Sprache zu übersetzen, anstatt sie zu verkomplizieren. Wir fordern ein Ende verschlossener Türen; es ist an der Zeit, diese Türen zu öffnen!
Um diese Räume zu öffnen, muss die Rolle, die Ökonom:innen in unserer Gesellschaft spielen, anerkannt werden. Es ist an der Zeit, dass die verschiedenen Kategorien der Machtverhältnisse wie Klasse, Kaste, Rassismus, Geschlecht, Sexualität, Behinderung, Religion und Kolonialgeschichte neben vielen anderen Aspekten in den Mittelpunkt der Wissensproduktion innerhalb der Wirtschaftswissenschaften rücken. Wir wollen darüber unterrichtet werden, welche wirtschaftlichen Aspekte die Rolle eines Menschen in der Gesellschaft bestimmen. Dazu müssen sich Ökonom:innen ihrer eigenen Position bewusst werden, ihre potenziellen Vorurteile erkennen und kritisch reflektieren. Der Wandel muss in der gesamten Disziplin stattfinden, vom Hörsaal bis zur Konferenz, um einen wissenschaftlichen Raum zu schaffen, der wirklich vielfältig und integrativ ist.
Die Disziplin versäumt es zu reflektieren, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert ein:e Ökonom:in zu sein. Die ökonomische Lehre, versäumt es zu hinterfragen, welche Kompetenzen sie ihren Studierenden zur Bewältigung aktueller Herausforderungen vermitteln muss. Darüber hinaus bleibt die Frage offen: Wie sollte ein:e Wirtschaftswissenschaftler:in im 21. Jahrhundert agieren? „Gute Wirtschaftswissenschaften“ sind kein Ziel, sondern ein ständiger Prozess der Neubewertung. Wirtschaftswissenschaftler:innen müssen sich ihrer Position in der Gesellschaft bewusst sein. Wir alle sind – ob wir es wollen oder nicht – voreingenommen und auch wenn diese Voreingenommenheit nicht beseitigt werden kann, so kann sie doch durch die Schaffung einer vielfältigen Disziplin minimiert werden. Wirtschaftswissenschaftler:innen sollten sich ihrer Stellung bewusst sein, sich aktiv zu ihren vertretenen Positionen bekennen und sie kritisch hinterfragen.
Dieses idealtypische Bild eines:einer Ökonom:in des 21. Jahrhunderts entspricht jedoch noch lange nicht Realität. Wir haben noch viel zu tun:
So könnt ihr dazu beitragen
Als Studierende:
Schließt euch der Bewegung zur Reform der Wirtschaftswissenschaften an. Findet eine Pluralo-Lokalgruppe in eurer Nähe. Wenn es keine gibt, nehmt Kontakt mit dem Netzwerk Plurale Ökonomik, Rethinking Economics oder oikos auf.
- Verschafft euch Gehör! Sprecht mit euren Kommiliton:innen, organisiert Treffen mit Angehörigen von Lehrstühlen.
Als Akademiker:innen:
- Hört den Studierenden eures Fachbereichs zu: Redet mit ihnen und nehmt ihre Anliegen ernst.
- Entwickelt Materialien, Kurse und Module, die euren Studierenden eine plurale, interdisziplinäre und vielfältige Ausbildung bieten und die in der realen Welt verwurzelt sind
- Strebt nach Veränderung: Vielfalt und Integration im akademischen Bereich sollten nicht nur einmal im Jahr geschehen, sondern eine konsequente Strategie sein, um greifbare Ergebnisse zu erzielen.
Als Unterstützer:innen unserer Arbeit:
- Setzt euch für Veränderungen ein: Diskutiert in eurem Netzwerk und tragt dazu bei, dass wirtschaftliche Themen zu gesellschaftliche Themen werden.
- Verstärkt unsere Stimmen: Verbreitet die Arbeit unserer Bewegung in euren Netzwerken.
- Unterstützt unsere Arbeit: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Organisationen und Bewegungen, die auf ähnliche Ziele hinarbeiten.
Wir leben in einem Zeitalter der multiplen Krisen, aber es ist auch ein Zeitalter des Wandels, des Nachdenkens und vor allem der Hoffnung. Die Bewegungen auf der ganzen Welt haben eine enorme Widerstandskraft bewiesen und streben nach Veränderung; Bewegungen für die Rechte indigener Völker, Selbstverwaltung, Demokratie, Klimaschutz, gegen Rassismus und viele andere haben die Kraft kollektiven Handelns und Denkens aufgezeigt. Rethinking Economics sieht sich in Solidarität mit diesen Bewegungen, sowohl in strategischer als auch in aktivistischer Hinsicht. Wir laden euch ein – ob als Student:in, Akademiker:in oder Interessierte – uns zu unterstützen und zur kritischen Masse dazu beizutragen, die notwendig ist, um die Wirtschaftswissenschaften in das 21. Jahrhundert zu befördern.